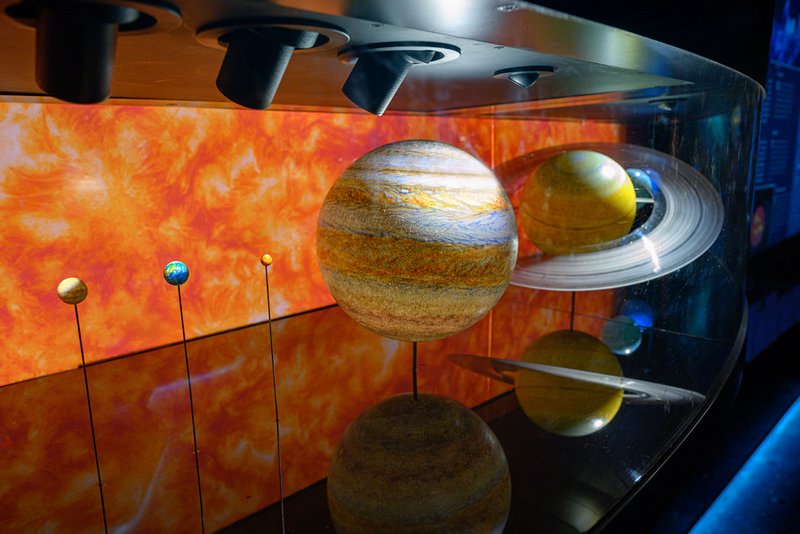Landtagsabgeordneten August Prinzinger kaufte als Gründer des Naturschutzparks im hinteren Stubachtal 1.100 Hektar Almgebiet mit der Absicht, charakteristische Landschaften in den Hochalpen als Naturschutzgebiete zu retten. Damit wurde der Grundstein zum heutigen Nationalpark Hohe Tauern gelegt. Es waren noch weitere Land-Ankäufe geplant, jedoch kamen hier der Erste Weltkrieg und die darauffolgende Weltwirtschaftskrise dazwischen. Doch ein Teil der Hohen Tauern wurde vom Land Salzburg vorerst als Pflanzenschutzgebiet ausgewiesen.

Der Nationalpark Hohe Tauern mit seinen 805 Quadratkilometern: Hier darf die Natur Natur sein.
Landesrätin Maria Hutter
Tauernwerk-Projekt verhindert
Der Nachfolger Prinzingers, Heinrich Medicus, setzte sich massiv gegen ein Tauernwerk-Projekt ein, das die Nutzung aller Tauernbäche, zwei Stauwerke im Kapruner Tal (Mooserboden, Orglerboden) und eine riesige Stufe bei St. Johann im Pongau vorsah. Ein weiterer Schritt Richtung Schutzgebiet.
Seilbahn abgewendet
Als 1935 die Großglockner Hochalpenstraße eröffnet wurde, tauchten weitere Visionen auf: Vom Wasserfallwinkel am Ende des Gamsgrubenweges sollte eine Seilbahn auf den Fuscherkar-Kopf errichtet werden, doch die Grundbesitzer - der Deutsche und Österreichische Alpenverein - gewannen vor dem Höchstgericht und legten strenge Auflagen für den Bau des Gamsgrubenweges fest.
Seit Ende der 1950er Jahre Tauerntäler geschützt
Nach Abzug der Alliierten kehrte auch in vielen Tälern Ruhe ein und viele wurden 1958 vom Land Salzburg zu Landschaftsschutzgebieten erklärt, wie etwa das Wildgerlostal, das Krimmler Achental, das Ober- und Untersulzbachtal, sowie das Habach- und Felbertal, Amertaler Öd und Dorfer Öd. Das Land Kärnten stellte 1964 seinerseits die Schobergruppe und 1967 den Großglockner mit Pasterze sowie Gamsgrube unter Landschaftsschutz.
1971: Drei Bundesländer - ein Nationalpark
Formal wurde die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern mit der Unterzeichnung der Dreiländer-Vereinbarung durch die drei Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol in Heiligenblut am 21. Oktober 1971 beschlossen.
Hier darf die Natur Natur sein
Die einzelnen Umsetzungsschritte dauerten in den drei Ländern unterschiedlich lange und zogen sich zum Teil über mehrere Etappen hin, 1983 wurde schließlich der Salzburger Teil verbrieft und besiegelt. Heute verpflichten sich die teilnehmenden Länder und Gemeinden, die uralte Natur- und Kulturlandschaft nachhaltig zu nützen und zu erhalten, die Nationalparkverwaltungen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tragen einen wesentlichen Teil dazu bei.
Natur hautnah und dennoch mit Abstand erleben
In den vergangenen Jahren hat sich der Nationalpark zum Besuchermagnet für Naturliebhaber aus allen Erdteilen entwickelt. Doch auf Grund der Corona-Krise stehen heuer keine großen Veranstaltungen auf dem Programm. „Das Naturerlebnis ist aber jederzeit gegeben. Die Nationalparkverwaltung mit ihren Rangern bietet ein umfangreiches Sommerprogramm an. Unterschiedlichste Themen werden auf einfachen Wanderungen bis hochalpinen Touren behandelt. Und jeder kann den Nationalpark auch selber erkunden: Dies ist auf dem riesigen Areal mit ausreichend Sicherheitsabstand – oft in Einsamkeit - möglich. Es gibt genügend Wege und Infrastruktur, um weder Fauna noch Flora zu stören. Dennoch ist es ein hautnahes Erleben der Natur“, lädt die Ressortleiterin des Nationalparks, Landesrätin Maria Hutter, ein. REP_200710_10 (ram/mel)